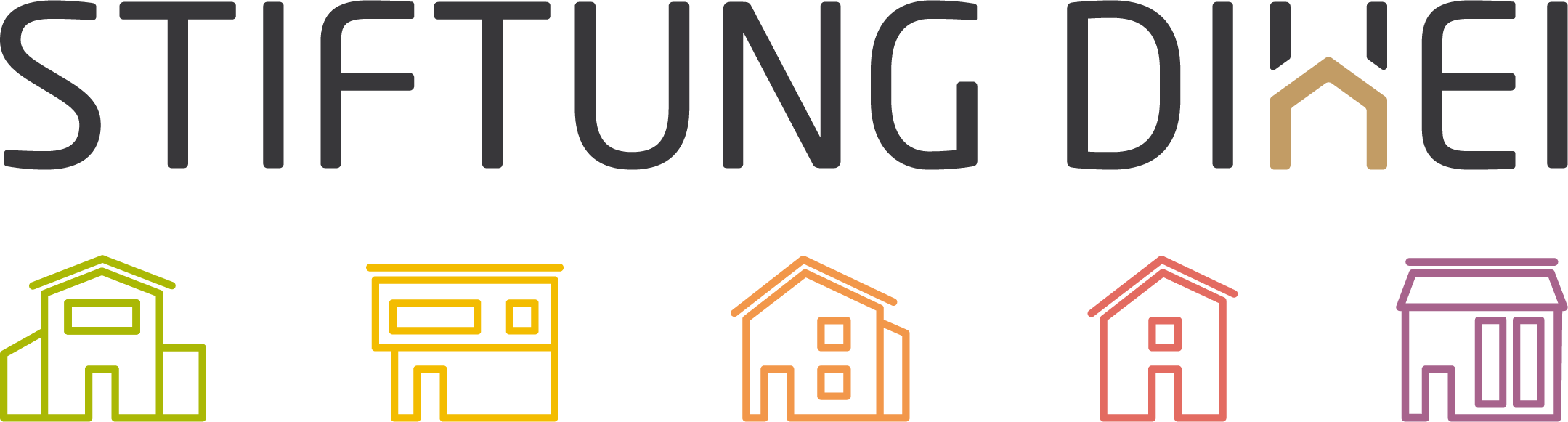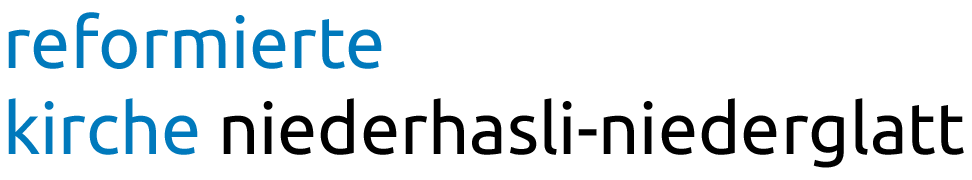Pasqualina Perrig-Chiello: «Das Alter gehört dir!»
Frau Perrig-Chiello, welche Entwicklungen sind zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr entscheidend, damit es gut weitergeht?
Pasqualina Perrig-Chiello: Zwischen 60 und 70 passiert einiges – aber der grosse Lebensübergang ist die Pensionierung. Es ist der Moment, in dem wir eine vertraute Rolle – etwa die als Berufsfrau oder Berufsmann – ablegen und in eine neue Lebensphase eintreten, die oft «Ruhestand» genannt wird. Ein unpassender Begriff, denn diese Phase ist alles andere als ruhig. Es ist eine Zeit intensiver Entwicklung: Wir müssen uns neu definieren – gesellschaftlich, in unserem sozialen Umfeld und auch individuell. Die Frage ist: Wer bin ich jetzt, mit einem anderen Lebensrhythmus, mit neuen sinnstiftenden Aktivitäten?
Sie sprechen in Ihrem Buch «Own Your Age» von einer aktiven Aneignung des Alters. Warum dieser englische Titel?
'Weil «Own Your Age» auf den Punkt bringt, worum es geht: Das Alter soll nicht etwas sein, das uns passiert, sondern etwas, das wir aktiv gestalten. Wir leben heute in einer Gesellschaft mit einer nie da gewesenen Lebenserwartung, oft bei guter Gesundheit. Aber wir leben auch mit vielen Stereotypen darüber, wie man im Alter «zu sein hat». Mein Appell: Lassen Sie sich das nicht diktieren. Machen Sie Ihr Alter zu Ihrem. Es geht nicht darum, das Alter zu bekämpfen, sondern es bewusst zu leben. Nicht «Act your age!» (Verhalte dich altersgemäss!), sondern «Own your age!» (Nimm dein Alter selbst in die Hand!).
Was bedeutet das konkret für die Identitätsentwicklung im Alter?
Identität ist nie abgeschlossen. Sie ist ein lebenslanger Prozess. Sie besteht aus einem inneren Kern – unserer Persönlichkeit – und den sozialen Rollen, die wir einnehmen. Wenn sich das Umfeld ändert, etwa durch den Umzug ins Altersheim, durch Verwitwung oder späte Scheidung, dann müssen wir uns neu definieren. Dabei spielen eigene Werte ebenso eine Rolle wie die Wahrnehmung durch andere. Identität entsteht immer im Spannungsfeld zwischen dem, was wir selbst glauben zu sein, und dem, wie uns andere sehen.
Und was hilft, um diesen Übergang gut zu gestalten?
Zentral sind drei Ebenen: die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie soziale Sicherheit und Gesundheitsversorgung, das soziale Umfeld – also Freundschaften und Familie – und schliesslich die individuelle Ebene. Besonders wichtig ist hier die Selbstverantwortung: Gewissenhaftigkeit zum Beispiel – klingt unattraktiv, ist aber extrem wichtig. Wer für sich selbst sorgt, sich weiterbildet, sich bewegt, hat bessere Chancen auf ein gutes Alter. Auch Eigensinn ist entscheidend: Ich weiss, was mir guttut, und richte mein Leben danach aus! Das stärkt unsere Selbstwirksamkeit – das Gefühl, etwas bewirken zu können.
Also ein klares Plädoyer für Eigenverantwortung?
Absolut. Ich erinnere mich an einen hochaltrigen Herrn, der mir einmal sagte: «Man muss sich vorstellen, man ist in einem Boot. Der da oben schickt Wind und Wetter – aber rudern muss ich selbst.» Das bringt es auf den Punkt. Natürlich können wir nicht alles beeinflussen. Aber vieles liegt in unserer Hand. Diese Haltung ist entscheidend für psychisches Wohlbefinden und Lebensqualität.
Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Umgang mit diesen Veränderungen?
Ja. Frauen haben tendenziell bessere soziale Netzwerke, tiefere Bindungen und sind offener im Umgang mit Krisen. Männer tun sich oft schwerer, Hilfe anzunehmen. Das hat mit Sozialisation zu tun. Aber auch Männer können es lernen. Vieles ist lernbar, wie übrigens auch Humor eine erlernbare und wichtige Ressource für alle ist. Humor hilft, das Leben leichter zu nehmen, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Man kann das trainieren, etwa mit einem Tagebuch der komischen Momente des Tages. Humor schützt vor Grübelei – und bringt oft die nötige Distanz zum eigenen Drama.
Kommen wir zur Partnerschaft. Was verändert sich nach der Pensionierung in langjährigen Beziehungen?
Die Pensionierung ist ein Einschnitt, weil der gemeinsame Alltag sich verändert. Loriots Film «Papa ante portas» bringt das wunderbar auf den Punkt. Die Menschen verbringen auf einmal sehr viel mehr Zeit miteinander – das kann Nähe bringen, aber auch Konflikte. Die Langlebigkeit unserer Beziehungen stellt neue Anforderungen. Viele Paare erleben eine schleichende Entfremdung. Unsere Studien zeigen, dass das der Hauptgrund für späte Scheidungen ist: Man lebt sich auseinander, hat keine gemeinsamen Projekte mehr.
Was kann man dagegen tun?
Zentral ist die Balance zwischen individueller Entwicklung und gemeinsamer Weiterentwicklung. Jede und jeder braucht ein eigenes Gärtchen, das gepflegt wird – aber auch gemeinsame Rituale oder Projekte. Kommunikation ist dabei der Schlüssel: Respekt, Wertschätzung, sich Zeit nehmen für den Austausch. Und ja, auch gemeinsame Werte und Ziele sind wichtig. Beziehungen, die nur nebeneinanderher laufen, haben es schwer.
Sie sprechen von zunehmenden Scheidungen im Alter. Was sind die häufigsten Gründe?
Wie gesagt: Entfremdung. Dann gibt es oft plötzlich auftretende Ereignisse – etwa, wenn eine Partnerin eine neue Liebe findet. Viele berichten, dass sie das völlig überrascht hat. Und natürlich sind auch Krankheit oder sich verändernde Werte mögliche Gründe. Unsere Forschung zeigt aber: Auch ältere Menschen erholen sich in der Regel gut von einer Trennung – entscheidend ist nicht das Alter, sondern die Persönlichkeit.
Und wie steht es mit Sexualität im Alter – wird sie nebensächlich oder bleibt sie bedeutsam?
Das kommt ganz darauf an, wie man Sexualität definiert. Wenn wir nur den Geschlechtsakt meinen, dann nehmen körperliche Einschränkungen natürlich zu. Aber Sexualität ist viel mehr: Nähe, Zärtlichkeit, Berührung – das bleibt wichtig. Paare definieren Intimität im Alter oft neu. Wer in jungen Jahren Wert auf Sexualität gelegt hat, wird das auch später tun. Und andere leben vielleicht eine eher kameradschaftliche Nähe. Wichtig ist, dass es für beide stimmt. Auch hier gilt: eigene Standards entwickeln – nicht dem gesellschaftlichen Bild folgen.
Ein weiteres wichtiges Thema in Ihrem Buch ist die Generativität – was verstehen Sie darunter?
Generativität meint das Engagement für nachfolgende Generationen. Es ist ein Bedürfnis, das mit dem Alter stärker wird – sei es in der Familie, im Ehrenamt, im gesellschaftlichen Leben. Es ist ein zentraler Faktor für Sinn und Lebenszufriedenheit. Wer das Gefühl hat, etwas weitergeben zu können, erfährt sich als wirksam und gebraucht. Das ist unglaublich stärkend.
Und welche Rolle spielt Spiritualität im Alter?
Für viele gewinnt Spiritualität im Alter an Bedeutung – sei es im religiösen Sinn oder als existenzielles Innehalten. Der Umgang mit Endlichkeit, mit Sinnfragen, mit Dankbarkeit. Auch das ist ein Entwicklungsfeld. Viele entdecken neue Rituale oder erleben mehr Tiefe im Alltag. Es geht darum, in Einklang zu kommen – mit sich selbst, mit dem Leben, mit dem, was war, ist und noch kommt.
Frau Perrig-Chiello, was ist Ihre wichtigste Botschaft an Menschen in der zweiten Lebenshälfte?
Warten Sie nicht darauf, dass jemand Ihr Alter für Sie gestaltet. Nehmen Sie es selbst in die Hand. Die besten Jahre sind oft nicht die ersten, sondern die, in denen man bewusst lebt. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie in Beziehung – zu sich selbst und zu anderen. Und vor allem: Seien Sie eigensinnig – im besten Sinn des Wortes.
René Winkler ist Leiter Akademie GenerationPLUS des Theologischen Seminars St. Chrischona (tsc). Zusammen mit Christiane Rösel, Referentin und Autorin, hat er den Podcast «Vorwärtsleben» gestartet, aus dem dieser Gesprächsauszug stammt. Ähnliche Impulse gibt es im Magazin LEBENSLAUF. Infos zum günstigen Jahresabogutschein des Magazins findest du hier.
Zum Thema:
Älter werden: Wie man mehr als nur Jahre dazugewinnt
Inspirationstag Perspektive 3D: Das Älterwerden neu denken
Überlebenstipps: Wie der Glaube im Alter stark bleibt